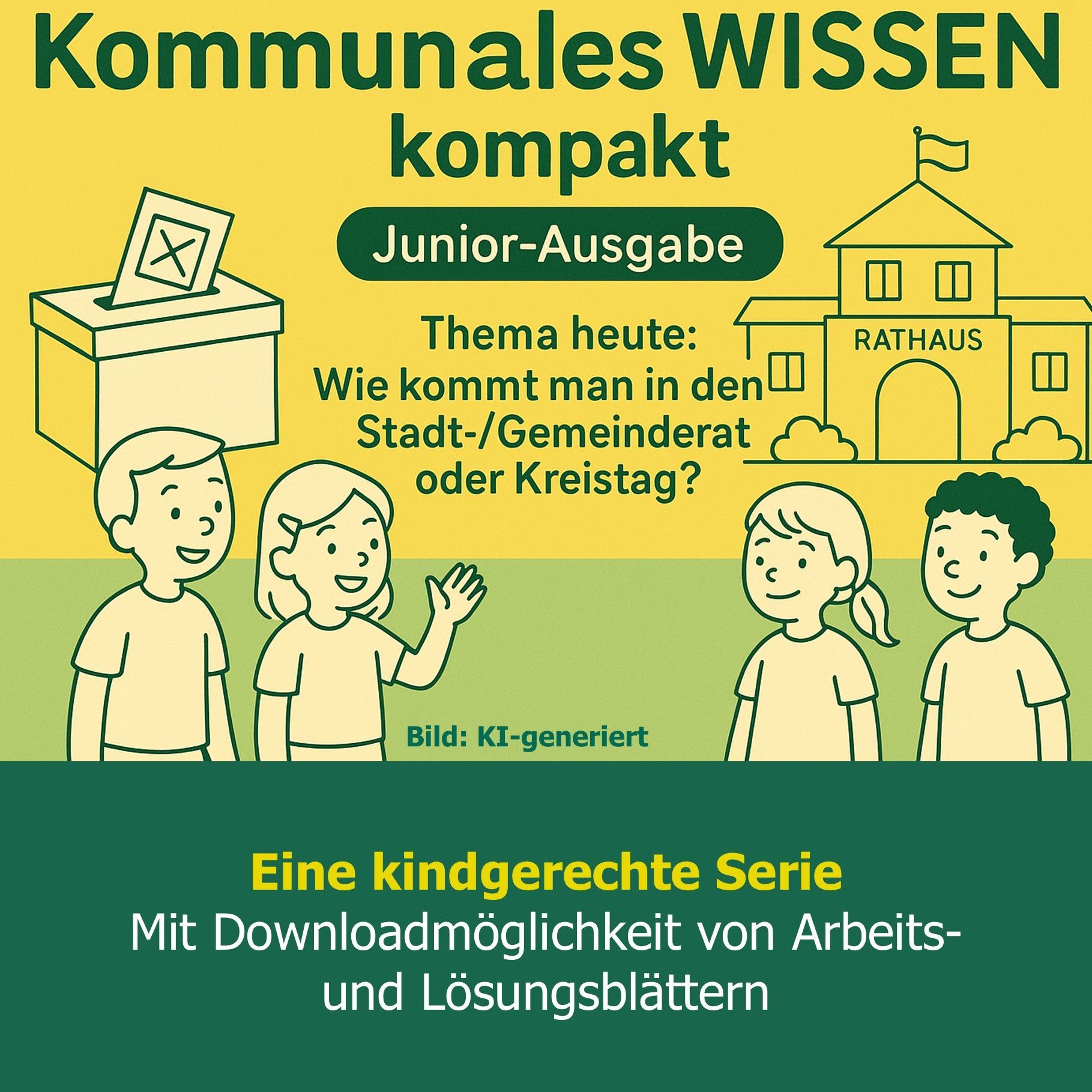Entscheidungen nicht zu Ende gedacht - Zukunft der Feuerwehr ungewiss
Für die Weilerswister Politik standen in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14.03. wichtige Diskussionen rund um die Zukunft der Feuerwehr an. Für die UWV-Fraktion stellte sich jedoch die Frage, auf welchen Grundlagen die weitreichenden Entscheidungen getroffen werden sollten. Fraktionsvorsitzender Uwe Wegner: „Mit Verwunderung stellen wir fest, dass sich Fraktionen schon sicher waren, wie sie die Zukunft der Feuerwehr, insbesondere an den Standorten Lommersum, Vernich und Weilerswist sehen. Aus unserer Sicht mangelt es aber an einigen Grundlagen."
„Die Unabhängigen“ sind offen für Problemlösungen. Voraussetzung muss jedoch sein, dass alle relevanten Umstände auf den Tisch kommen und berücksichtigt werden. Genau an dieser Stelle sieht Matthias Müller, Ratsmitglied der UWV, jedoch erhebliche Defizite: „Der Politik wurden in mehreren Sitzungen relevante Unterlagen zugesichert, die uns zumindest, bis heute nicht vorliegen.“ Damit verweist Müller insbesondere auf die Berichte der Unfallkasse NRW sowie der versprochenen Gefährdungsbeurteilung. Zwar wurde Ende November 2023 ein Vortrag im Fachausschuss gehalten worden, aber verlässliche Aussagen, welche Maßnahmen insbesondere zu welchen Kosten an welchen Standorten jeweils erforderlich sind, stehen bis heute in keiner Verwaltungsvorlage für die politischen Gremien der Gemeinde. Es gibt keine Prioritätenliste für die einzelnen Standorte. Die Verwaltung will sukzessive für einzelne Standorte und Probleme Beschlussvorlagen liefern. Einen Gesamtüberblick haben die Politiker bis heute nicht. (Für Hintergründe dazu hier klicken).
> Belastbare Berechnungen liegen nicht vor. <
Die UWV kommt zu dem Ergebnis: es können aktuell keine belastbaren Aussagen zu den finanziellen Auswirkungen von Instandsetzungs- sowie Sanierungsnotwendigkeiten an sämtlichen Feuerwehrgerätehäusern getroffen werden. Ebenso ist die zeitliche Abfolge gänzlich unbekannt. Dies gilt auch für mögliche Neubauten an gleicher Stelle. An einigen Standorten werden dabei einige zusätzliche Problemlagen und Fakten ausgeklammert.
Die von CDU und SPD aufgebrachten Ideen zu Sanierungen, Erweiterung und Teilverlagerungen für Weilerswist und Vernich klingen z. B. auf den ersten Blick zunächst interessant. Leider sind dabei jedoch in Bezug auf Weilerswist und Vernich relevante und damit wesentliche Umstände in den Überlegungen nicht zu Ende gedacht. Unter anderem denkt man bei den politischen Mitbewerbern an eine Verlagerung des Bauhofes und Nutzung der dann irgendwann möglicherweise frei werdenden Bauhof-Immobilie als Erweiterung für den Standort der Löschgruppe Weilerswist. Wegner zu diesen Ideen: „Gebäude, die der Feuerwehr dienen, fallen in Hinblick auf eine Erdbebensicherheit baurechtlich in die sog. Bedeutungskategorie 4. Hier werden besondere Anforderungen definiert, welche für die meisten anderen Nutzungen, etwa für Gewerbe und Bauhof, nicht gelten.“
Dies Vorgabe gilt auch bei temporären Nutzungen. Ganz gleich, ob es sich dabei um Neubauten (in welcher Form auch immer diese errichtet werden) oder um bloße Nutzungsänderungen bestehender Gebäude handelt. Diese heute gültigen Normen müsste man dann bei den für die Umsetzung dieser Ideen notwendigen neuen Bauanträgen, ebenso bei Nutzungsänderungen, beachten. Was dies in der Realität bedeutet scheint einigen Kommunalpolitikern nicht klar zu sein.
> Mehr als fraglich, ob Ideen überhaupt realistisch sind. <
Damit ist für die UWV mehr als fraglich, ob überhaupt und wenn, mit welchem Zeit- und Finanzaufwand solche CDU/SPD-Lösungen für Weilerswist und Vernich tatsächlich realistisch sind. Zudem sind sowohl die Verlagerung des Bauhofes als auch die mögliche Nutzung einer bestehenden Gewerbeimmobilie nicht zum Nulltarif zu bekommen. Für eine Einschätzung und hierauf basierende Entscheidungen fehlen schlichtweg belastbare Darstellungen und Berechnungen. Sofern sich diese überhaupt valide berechnen lassen, ist für einen solchen von CDU und SPD nun zunächst beschlossenen Prüfauftrag ein massiver Zeit- und Personalaufwand erforderlich. Wann das Ergebnis derartiger Prüfungen vorliegt, konnte in der Sitzung niemand beantworten, Erst nach der Kommunalwahl 2025?
> Andere Probleme werden nicht gelöst. <
Dabei werden nach dieser sinnlosen Prüfung für Weilerswist und Vernich andere Probleme nicht aus der Welt geschaffen. Etwa die Frage nach der Erreichbarkeit des Standortes Weilerswist durch die ehrenamtlichen Wehrleute. Es ist vorhersehbar, dass in wenigen Jahren die Schrankenanlagen der DB an der Bonner Straße häufiger geschlossen sein wird. Damit steigt die Gefahr, dass die Einsatzkräfte auf dem Weg zu Ihrem Standort an der Schranke warten und verspätet eintreffen. Dies würde dann wiederum dazu führen, dass die Feuerwehr bei manchen Einsätzen nicht mehr innerhalb der rechtlich vorgegebenen Fristen am Einsatzort antrifft.
Für den Standort Vernich hat die Wehrleitung der Feuerwehr darauf hingewiesen, dass der Standort im Hochwasserüberschwemmungsgebiet liege. Die UVW stellt daher in Frage, ob es daher wirklich Sinn macht, an diesem Standort mehr Geld in die Hand zu nehmen als wirklich unbedingt nötig. UWV-Ratsherr Müller: „Niemand von uns würde unter diesen Voraussetzungen privat an einem solchen Ort Geld investieren. Warum also sollten wir dies dann mit dem Geld aller Bürgerinnen und Bürger machen? Wäre das nicht verantwortungslos?“
Im Ergebnis also ganz viel Aufwand für die Verwaltung und das für nicht zukunftsfähige Ideen.
> Fortführung der bisherigen Planungen wäre konsequent. <
Eine Fortführung der Detailplanung für eine neue Feuerwache, gemeinsam für Weilerswist/Vernich wäre demnach konsequent gewesen. Bereits seit 2014 beschäftigt sich die Weilerswister Politik mit diesem Ziel, wofür man gute Gründe hatte. Wegner: „Es ist bedauerlich, dass die Planung bisher derart schleppend gelaufen ist. Nun, wo es weitergehen könnte, scheinen einige politisch Verantwortliche plötzlich kalte Füße zu bekommen.“
Weite Teile der Öffentlichkeit bekommen leider den Eindruck, dass Einzelne schon mitten im Kommunalwahlkampf stecken und damit aus Sorge vor Diskussionen immer weniger bereit sind Verantwortung zu übernehmen. Mehr noch: in Teilen hat es den Anschein, dass man zunehmend die Öffentlichkeit auch mit nicht belastbaren Aussagen in die Irre führt.
Dies betreffe beispielsweise auch die Kostensumme für eine neue Wache. Hier liegen in den Ausführungen der einzelnen Akteure grobe Abweichungen. Die Spanne liegt hier in den Darstellungen zwischen 18 und 30 Millionen Euro. Das zeigt bereits, wie unscharf die in den Vordergrund geschobenen Zahlen sind. Bisher liegt nur eine sehr rudimentäre Schätzung des Fachplaners vor. Die wiederum wird dann von Einzelnen eigenmächtig, nach welchen Parametern auch immer, nach oben "korrigiert". Über die Motivlage wollen „Die Unabhängigen“ nicht spekulieren. Unberücksichtigt bleibt zudem der Umstand, dass die Planung mehrere Ausbaustufen vorsieht, die einerseits nicht zeitgleich und andererseits nicht zwingend von der Gemeinde alleine getragen werden müssen. Sprich: in einem ersten Anlauf ist die unseriöse in den Raum gestellte Gesamtsumme gar nicht komplett der korrekte Bewertungsmaßstab, wenn man die Kosten eines Neubaus mit Sanierungen und Erweiterungen an alten, problembehafteten Standorten gegenüberstellt.
> In den Raum gestellte Kosten sind fragwürdig. <
Müller: „Es wird zudem so getan, als ob für ein vermeintlich zu großes und zu teures Feuerwehrgerätehauses zwingend Steuern erhöht werden müssten. Einen Nachweis darüber sind die Skeptiker bisher allerdings schuldig geblieben.“ Die UWV weist darauf hin, dass der Kämmerer schon heute in der Finanzplanung für das Jahr 2025 Steuererhöhungen einplane. Fakt ist allerdings auch: es sind bisher gar nicht einmal alle denkbaren Finanzierungsmöglichkeiten geprüft worden. Ein dahingehender Antrag der UWV-Fraktion wurde letzten Jahres zwar beschlossen, auf ausdrücklichen Wunsch des Fraktionsvorsitzenden der CDU jedoch mit einem sog. „Sperrvermerk“ versehen. Ziel: erst nach abermaliger Beratung des UWV-Antrages, könnten für die Prüfung notwendigen Finanzmittel freigegeben werden. Immerhin wurde diese Einschränkung in der Sitzung vom 14.01. nach einigen Diskussionen zurückgenommen. Dies bedeutet dennoch: eine objektive Prüfung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten, im Sinne des UWV-Antrages, kann nicht vor Sommer diesen Jahres erfolgen.
CDU und SPD treiben mit ihren Mehrheitsbeschluss faktisch den Ausstieg aus dem Projekt „Neubau Feuerwehr Weilerswist/Vernich“ voran. Und dies, obgleich die Argumentation für eine angeblich sinnvolle Prüfung von Alternativen auf hölzernen Beinen steht. Die Aussage, der sich abzeichnenden neuen Mehrheiten im Rat, man würde keine Beschlüsse gegen den neuen Standort fassen, vermag nicht zu überzeugen. Formal ist dies zutreffend, durch anderweitige Beschlüsse torpedieren CDU und SPD faktisch jedoch das Projekt. Und dies in dem Wissen, dass wesentliche Aspekte in den Überlegungen unberücksichtigt und als Problem ungelöst bleiben. Zumindest für einen nicht unerheblichen und abermaligen Zeitverzug in der Planung tragen CDU und SPD damit die volle Verantwortung.
Eine hohe Priorität erkennt die UWV, wie alle anderen Fraktionen, parallel dazu durchaus für das Feuerwehrgerätehaus Lommersum. Neben dem grundsätzlich schlechtem Zustand liegt der aktuelle Standort ebenfalls in einer Überschwemmungszone. Hier scheinen die Fraktionen von CDU und SPD, im Gegensatz zu Vernich, durchaus für problematisch zu halten. Bei der notwendigen Planung für einen neuen Standort soll nach Auffassung der „Unabhängigen“ die Löscheinheitsleitung Lommersum eng eingebunden werden.
Foto: Uwe Wegner